Können Online-Kampagnen die Welt verändern?

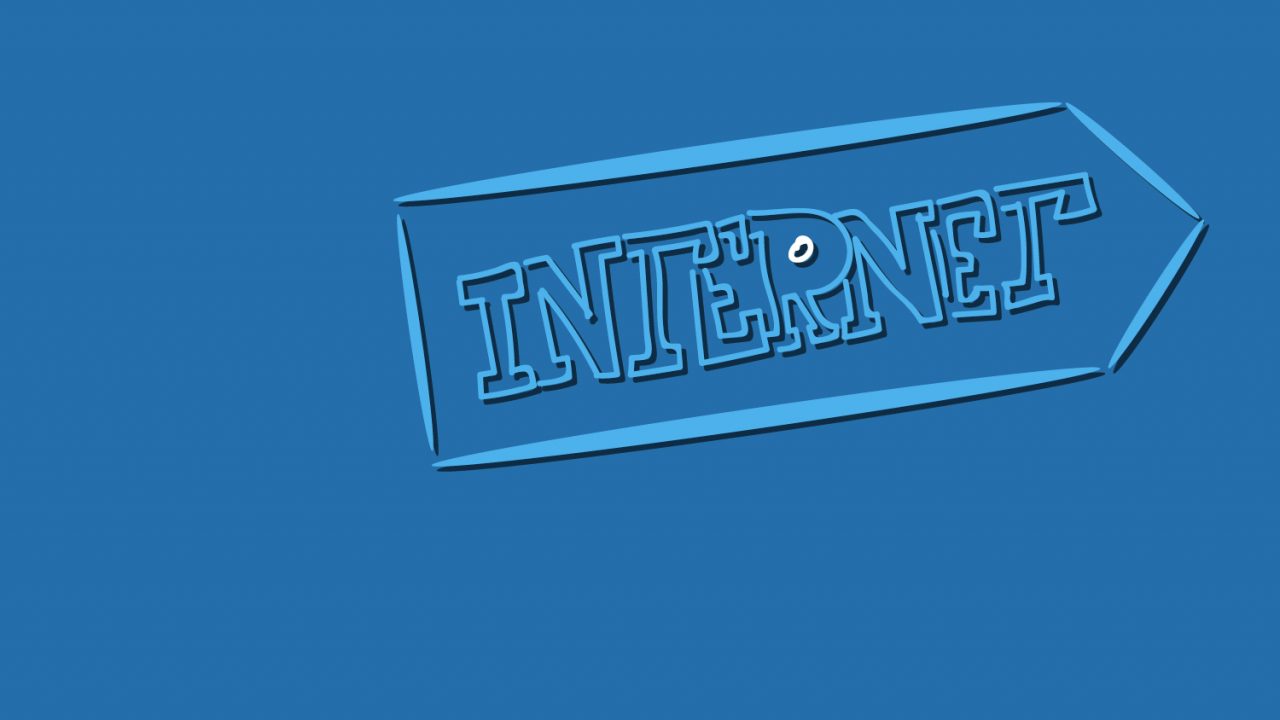
Online-Kampagnen sind längst zu einem beliebten Instrument der politischen Partizipation geworden. Doch: Welche Wirkung haben sie tatsächlich auf die Abgeordneten und ihre politischen Entscheidungen.
Johannes Hilje hat im Bundestag nachgefragt und die Ergebnisse jüngst in seiner Studie Klick-Aktivismus? Online-Kampagnen in der Politik vorgestellt. Wir haben mit ihm über Partizipation, Online-Kampagnen und die Chancen sozialer Medien gesprochen.
Zugang und Kompetenz zentrale Voraussetzungen
Welche Voraussetzungen braucht eine Gesellschaft, damit sich diese Partizipationsmöglichkeiten entfalten können?
Direkter Dialog zwischen Bürgern und Abgeordneten
Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit stellt der Faktor Partizipation dar. Diverse Volksabstimmungen und Bürgerbegehren haben gezeigt: Die Bereitschaft, als Bürger aktiv zu werden und sich zu engagieren, ist eher gering. Kann das Internet diesen Umstand ändern?
Ich glaube nicht, dass die Partizipationsbereitschaft gering ist. An der Volksabstimmung zu Stuttgart 21 haben im Stuttgarter Stadtgebiet 67% teilgenommen – knapp mehr als bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg insgesamt. Weil aber das ganze Bundesland an der Abstimmung über den Bahnhof teilnehmen durfte, war die Beteiligung insgesamt geringer. Ich glaube das Entscheidende ist, dass politische Themen den Bürgern auf eine Weise vermittelt werden, dass sie für den einzelnen Menschen relevant erscheinen. Damit meine ich, dass die Bürger einen Zusammenhang zwischen einer politischen Sachfrage und ihrer eigenen Lebensrealität sehen müssen. Die Medien und die Politik selbst schaffen das in vielen Fällen nicht. Das Internet bietet hierfür einen weiteren Kanal, insbesondere für Politiker, um direkt zu den Menschen zu kommunizieren. Mit der steigenden Beliebtheit sozialer Netzwerke, können viele Menschen nun sogar in einem Raum angesprochen werden, der als so etwas wie eine “private Öffentlichkeit”, also als eine halbwegs private Sphäre wahrgenommen wird. Darin liegt eine große Chance, glaube ich.
Internet und Wahlkampf
Nächstes Jahr wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Schon vor vier Jahren gab es erste „Versuche“, Online-Kommunikation in die Kampagnen-Planung zu involvieren. Was können wir nächstes Jahr von den Volksparteien erwarten?
Im letzten Wahlkampf wurde viel experimentiert, zum Teil wurden blind Praktiken aus der Obama-Kampagne, wie etwa das Online-Fundraising, übernommen. Ich glaube und hoffe, dass die Parteien das Netz strategisch klüger einsetzen werden. Optimistisch bin ich daher, weil in der Zwischenzeit viel passiert ist: Die Kanzlerin führt mittlerweile einen Videoblog, die SPD will ihr Wahlprogramm mit der Bevölkerung online erarbeiten und viele Abgeordnete sind bei Facebook und Twitter unterwegs. Die Parteien und Kandidaten wären gut beraten, eine sorgfältig durchdachte Strategie für soziale Netzwerke zu entwickeln. Bei Facebook können sie mittlerweile nicht mehr nur Jugendliche erreichen, auch Menschen über 35 Jahren sind dort zunehmend vertreten. Doch die Politik muss hier selbst aktiver werden. Warum nicht auch ’mal selbst „Freundschaftseinladungen“ an die Bürger versenden?
Kontrolle der politischen Elite
Gibt es Ihrer Meinung nach neben „Klick-Aktivismus“ andere Formen der politischen Partizipation, die durch das Internet ermöglicht werden?
Es gibt unzählige Formen der politischen Online-Partizipation, zwei finde ich besonders bemerkenswert. Im Fall von Karl-Theodor zu Guttenberg haben Bürger online zusammengearbeitet, um das Fehlverhalten eines Ministers aufzudecken. Transparenz und Kontrolle der politischen Elite sind hierfür die Überbegriffe.
Das zweite Beispiel ist die Piratenpartei, deren Mütter und Väter das erste Parteiprogramm im Internet erarbeitet haben. Die Piraten haben mit Hilfe des Netzes eine Partei gegründet, die schon in mancher Sonntagsumfrage mehr Prozent als die mitregierende FDP bekommen hat. Beide Beispiele zeigen, dass Bürger mittels des Internets die politische Bühne nachhaltig beeinflussen können.
Die Beteiligung über das Internet sei nach Meinung der Befragten nicht echt, da Kampagnen schon fertig formuliert sind. Gibt es Ihrer Meinung nach einen anderen Weg, die Partizipation Vieler zu organisieren?
Wenn es sowohl von den Initiatoren als auch den Teilnehmenden gewollt ist, gibt es Online-Instrumente, die es erlauben, dass viele Menschen zusammen etwas erarbeiten, zum Beispiel den genauen Wortlaut einer Petition. Ich denke grundsätzlich stellt sich bei Online-Kampagnen die Frage, ob sie wirklich Bürgerbeteiligung stimulieren wollen, oder aber bestimmte Interessen vertreten und dabei die „Masse“ als legitimierendes Mittel im Rücken nutzen möchten. Diese Frage lässt sich nicht für alle Online-Kampagnen pauschal beantworten. Es ist aber immer gut, wenn die Beteiligten eine Möglichkeit haben ihrem partizipativen Klick eine eigene Note beizufügen, zum Beispiel, in dem Text sie den E-Mail-Text bei einer E-Mail-Kampagnen an die Kanzlerin verändern können. Dass Petitionstexte beim Unterzeichnen nicht mehr beeinflusst werden können, liegt übrigens nicht am Internet, sondern an der Natur der Petition.
Direkter Dialog durch soziale Netzwerke
Wie bewerten Sie etwa das Potential, das soziale Medien mitbringen, indem sie einen direkten Kommunikationskanal zwischen Bürgern und Abgeordneten schaffen?
Viele Menschen nutzen soziale Netzwerke für ihre private Kommunikation, die aber in einem halb-öffentlichen Raum stattfindet. Das bedeutet, dass man Menschen dort erreichen kann, wo sie sich sowieso gerne aufhalten. Ich sehe darin eine große Chance für die Politik, denn der Bürger muss die politischen Nachrichten nicht selbst abrufen, sondern bekommt die Nachricht seines Abgeordneten direkt unter den Urlaubsfotos der besten Freundin angezeigt.
Aber auch hier gilt, dass das Potenzial nur genutzt werden kann, wenn Politiker richtig damit umgehen. Manche Abgeordnete lassen ihre Twitter- und Facebooknachrichten von Mitarbeitern schreiben. So etwas ist schnell am Schreibstil und Reaktionsverhalten auf Bürgerfragen zu erkennen und erzeugt letztlich eher negatives Feedback.
Verzahnung von On- und Offline entscheidend
Nehmen wir an, dass Online-Partizipation tatsächlich die Gesellschaft grundlegend verändern kann und wird: Werden Menschen in 15 oder 20 Jahren überhaupt noch auf die Straße gehen, um für oder gegen etwas zu protestieren?
Es wäre schlimm, wenn es die Menschen nicht mehr tun würden. Ein Beispiel aus meinen Gesprächen mit den Berliner Politikern: Wenn 20.000 Bürger dem Abgeordneten eine E-Mail schreiben, kann er im Zweifel einfach sein E-Mail-Programm schließen oder einen Spam-Filter einsetzen. Wenn aber 20 Menschen vor seinem Büro demonstrieren und den Eingang versperren, muss er sich zweifelsohne das Anliegen anhören und eine Antwort anbieten. Die Wirkung des physischen Protests ist in vieler Hinsicht wesentlich größer. Die Medien berichten über 20 Zelte vor Frankfurter Banken, aber nicht über 200.000 E-Mails an die Kanzlerin.
Ein Mausklick verändert nicht die Welt
Die befragten Abgeordneten sind sich einig, dass sich die Bedeutung von Online-Kampagnen in Zukunft erhöhen wird. Welche Vorbereitungen sind zu treffen?
Einerseits müssen die Initiatoren von Online-Kampagnen den teilnehmenden Bürgern klar machen, welche Wirkung sie von ihrer Beteiligung erwarten können. Per Mausklick kann man nicht die Welt verändern. Gleichzeitig sollten sie die Effektivität ihrer Kampagnen steigern, indem sie ihre Online-Aktivitäten mit Aktionen in der realen Welt verbinden. Eine medienwirksame Übergabe einer großen Online-Petition an einen Politiker, kann zum Beispiel schon für wesentlich mehr Aufmerksamkeit sorgen.
Andererseits müssen Politiker ihr Wissen über Online-Kampagnen erweitern, die verschiedenen Instrumente kennen und auch wissen, wer Organisationen wie Campact oder Avaaz sind. Diese Namen hatte mancher Abgeordnete bei meinen Interviews noch nicht gehört. Wenn man weiß, dass diese Organisationen mitunter in wenigen Stunden zehn- bis hunderttausend Online-Unterschriften mobilisieren können, ist das eine unzeitgemäße Wissenslücke.
Werden Abgeordnete längerfristig Online-Partizipation zwangsläufig in politische Entscheidungen einbeziehen müssen?
Wenn sich mehr und mehr Bürger über Online-Beteiligungsmöglichkeiten in die Politik einbringen möchten, muss die Politik das ernst nehmen. Auch dann, wenn es eigene Kampagnen der Bürger sind und keine von der Politik konzipierten Beteiligungsverfahren. An solchen sollte die Politik hingegen selbst arbeiten. E-demokratische Elemente müssen für alle leicht zugänglich und bedienbar sein. Sie müssen zudem beworben werden und eine tatsächliche politische Wirkung entfalten können. Bis wir dort angekommen sind, gibt es noch einiges zu tun.
Zum Autor:
 Johannes Hilje absolviert ein MSc Programm in „Politics and Communication“ an der London School of Economics and Political Science. Neben seiner akademischen Tätigkeit ist er Vorsitzender der jungen Hilfsorganisation Go Ahead!, für die er 2010 die Kampagne kickHIV! konziperte und koordinierte. Zudem ist Johannes Hillje Mitglied im außenpolitischen Think Tank „Studentenforum im Tönissteiner Kreis“.
Johannes Hilje absolviert ein MSc Programm in „Politics and Communication“ an der London School of Economics and Political Science. Neben seiner akademischen Tätigkeit ist er Vorsitzender der jungen Hilfsorganisation Go Ahead!, für die er 2010 die Kampagne kickHIV! konziperte und koordinierte. Zudem ist Johannes Hillje Mitglied im außenpolitischen Think Tank „Studentenforum im Tönissteiner Kreis“.
Die komplette Arbeit kann angefordert werden unter j.hillje@lse.ac.uk.





