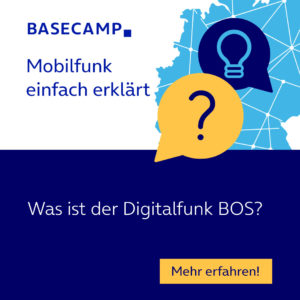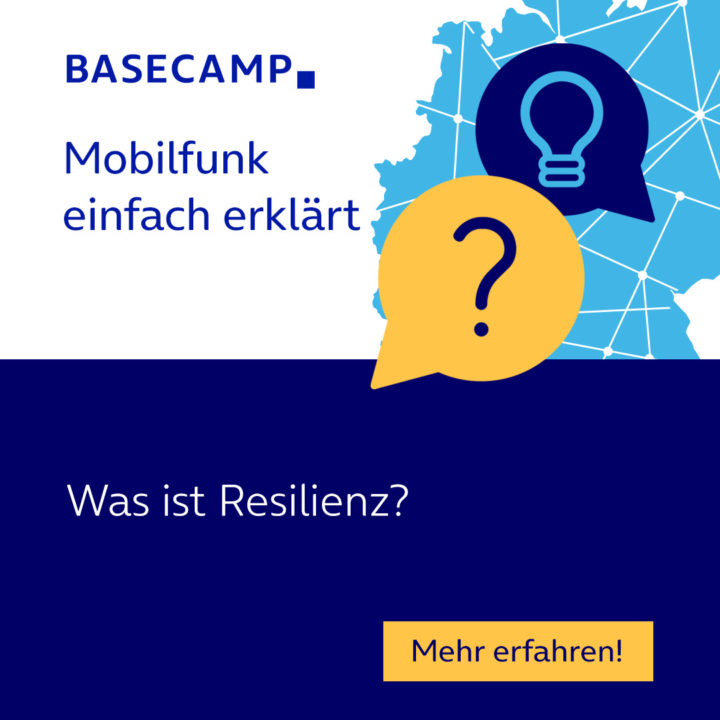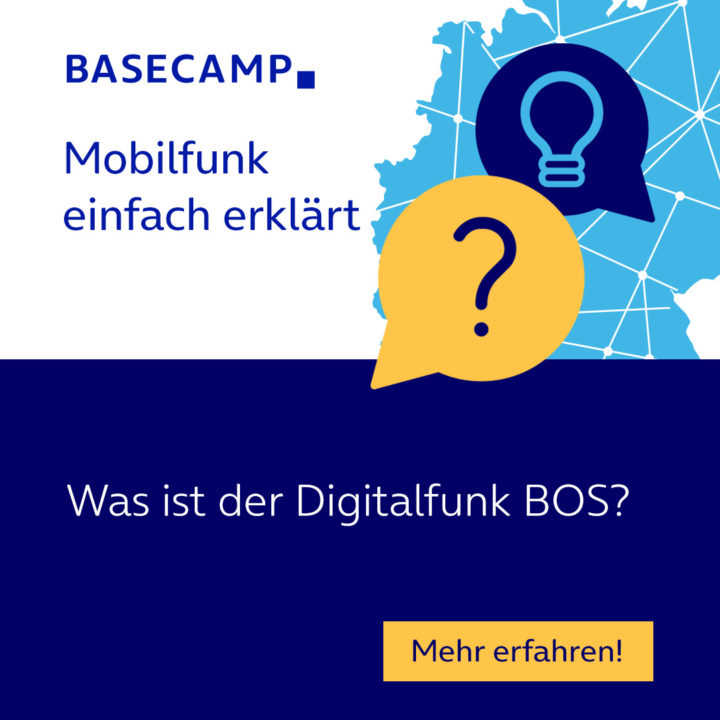Mobilfunk einfach erklärt: 5G und die Zukunft des Behördenfunks


Wir erklären, warum 5G eine wichtige Rolle für die öffentliche Sicherheit spielen kann, wieso das Funknetz für Behörden modernisiert werden muss und inwieweit daran bereits gearbeitet wird.
5G als die fünfte Generation des Mobilfunkstandards ist vor allem dafür bekannt, privaten Nutzer:innen und Unternehmen durch schnellere Datenübertragung, höhere Netzstabilität und neue smarte Vernetzungsmöglichkeiten eine Menge Vorteile zu bieten. Doch die neue Mobilfunktechnologie ist auch für die öffentliche Sicherheit von großer Relevanz – und zwar in mehrerer Hinsicht.
Vorteile für Rettungsdienste und Sicherheitsbehörden
Mit seiner enormen Bandbreite, den extrem niedrigen Latenzzeiten und der Fähigkeit, eine Vielzahl von Geräten gleichzeitig zu verbinden, verändert 5G die Arbeitsweise von Rettungsdiensten und Sicherheitsbehörden weltweit. So liefert es in kritischen Situationen wie Naturkatastrophen, Unfällen oder Terroranschlägen, in denen jede Sekunde zählt, die notwendige Infrastruktur, um eine schnellere und präzisere Reaktion zu ermöglichen.

Rettungskräfte können zum Beispiel wichtige Informationen wie Standortdaten oder Video-Feeds vom Einsatzort schnell und einfach untereinander austauschen und in Echtzeit auf hochauflösende Drohnenbilder zugreifen, um die Lage vor Ort besser einzuschätzen. Oder autonome Fahrzeuge, können nahtlos mit Verkehrsleitzentralen verbunden werden, um den sichersten und schnellsten Weg zu berechnen und sich gleichzeitig dynamisch an Verkehrslagen anzupassen, was die Sicherheit im Straßenverkehr erheblich verbessert.
Die Interoperabilität von verschiedenen Behörden und Organisationen wird durch 5G ebenfalls optimiert. Mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) können Sicherheitsbehörden proaktiv auf Bedrohungen reagieren und frühzeitig Maßnahmen einleiten, bevor diese eskalieren. Zugleich steigert das noch stabilere Netz die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der öffentlichen Sicherheitssysteme. In einer Welt, die zunehmend von digitalen Bedrohungen und schnellen Veränderungen geprägt ist, bietet 5G somit eine wichtige Grundlage, um die Resilienz von Sicherheitsinfrastrukturen zu stärken.
6G als Versprechen der Zukunft
Während 5G bereits große Fortschritte bringt, ist die Entwicklung von 6G nicht weit entfernt und wird die Möglichkeiten für Sicherheits- und Rettungsdienste weiter ausbauen. Mit noch höheren Geschwindigkeiten, einer weiter reduzierten Latenz und einer deutlich verbesserten Kapazität wird 6G dazu beitragen können, die öffentliche Sicherheit auf ein neues Level zu heben.
Dank der Integration fortschrittlicher KI wird 6G es ermöglichen, Bedrohungslagen idealerweise nicht nur reaktiv, sondern durch die Analyse von Falldaten vorausschauend zu erkennen. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden wird durch die neuartige Netzarchitektur weiter vereinfacht und gestärkt. Das ist zumindest die Vision für die Zukunft.
Die Grenzen des TETRA-Systems
Die Breitbandkommunikation für „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“, kurz: BOS, stellt jedoch besondere Anforderungen an die Resilienz, Ausfall- und Datensicherheit sowie Integrität der Netze. Staatliche Einsatzkräfte, Behörden und das Militär waren daher seit der Erfindung von Funknetzen darauf bedacht, eigene Netze für ihre Kommunikation zu etablieren.
Wirft man einen Blick in die Gegenwart, zeigt sich allerdings, dass der Ausbau des digitalen Behördenfunks in Deutschland noch vor großen Herausforderungen steht. Das derzeit genutzte TETRA-Netz (Terrestrial Trunked Radio), das vor allem Sprachkommunikation ermöglicht, reicht längst nicht mehr aus, um den Anforderungen an moderne Sicherheits- und Rettungsdienste gerecht zu werden.
So bietet TETRA zwar eine stabile Kommunikationsmöglichkeit, aber mit einer sehr niedrigen Bandbreite. Es ist nicht in der Lage, die Datenströme zu unterstützen, die heutzutage für die Arbeit der Behörden erforderlich sind. Beispielsweise können live übertragene Bilder oder Videos, die für die Einsätze von Polizei und Feuerwehr unverzichtbar sind, über TETRA nicht übertragen werden. Auch die Nutzung von sicheren Messenger-Diensten ist aufgrund der geringen Bandbreite unmöglich. In einer Welt, in der die digitale Kommunikation und Echtzeitdaten entscheidend für schnelle und koordinierte Maßnahmen sind, ist TETRA also völlig unzureichend.
Das momentane Fehlen einer zukunftsfähigen digitalen Kommunikationsinfrastruktur führt außerdem zu einer Fragmentierung der Systeme: Länderspezifische „Alternativen“ entstehen, die weder einheitlich noch interoperabel sind. Dies hat nicht nur technische, sondern auch datenschutzrechtliche Konsequenzen. Denn gerade in Krisensituationen ist es entscheidend, dass alle relevanten Akteure – von der Polizei über das THW bis hin zu Feuerwehr und Rettungsdienst – über dieselbe leistungsfähige und sichere Infrastruktur kommunizieren können. Andernfalls können Missverständnisse oder gar Kommunikationsausfälle fatale Folgen haben.
Wie der Behördenfunk modernisiert werden soll
Um den digitalen Behördenfunk auf eine moderne, zukunftsfähige Grundlage zu stellen, hat der Bund mehrere Projekte ins Leben gerufen. Ein Beispiel ist das Projekt der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS). Ziel dieses Vorhabens ist es, innovative Lösungen für den Ausbau eines breitbandigen Digitalfunks zu entwickeln, der mit den aktuellen Mobilfunktechnologien kompatibel ist. Momentan steht dabei die Entwicklung eines minimalen BDBOS-Kernnetzes mit Roaming-Option in allen drei öffentlichen Mobilfunknetzen sowie der möglichen Integration von Campusnetzen im Vordergrund.
Ein weiteres wichtiges Projekt ist das „KoPa_45“-Förderprogramm der BDBOS, das im August 2023 gestartet wurde. In diesem Programm arbeiten verschiedene Unternehmen an Lösungen, die den Behördenfunk mit modernen Mobilfunkstandards wie 5G und 6G kompatibel machen sollen. Ein Teil des Programms beschäftigt sich auch mit der Entwicklung von Edge- und Cloud-Technologien, um die Kommunikation in kritischen Einsatzsituationen zu optimieren.
Die Komplexität bei der Umsetzung dieser Projekte ist jedoch nicht zu unterschätzen. Die Integration von Mobilfunknetzbetreibern und die Schaffung eines interoperablen, bundesweit verfügbaren Netzes stellen technische und organisatorische Herausforderungen dar.
Kann Deutschland von Spanien lernen?
Andere europäische Länder zeigen bereits jetzt, wie die Zukunft der Kommunikationsinfrastruktur für Sicherheitsbehörden aussehen könnte. In Spanien beispielsweise wird ein leistungsfähiges Mobilfunknetz betrieben, das Sprach- und Datendienste für mehr als 120.000 Nutzer innerhalb der staatlichen Sicherheitsstrukturen bereitstellt. Dies zeigt, dass eine moderne und zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur für Behörden realisierbar ist – es bedarf nur eines entschlossenen politischen Willens und der Kooperation mit Mobilfunkunternehmen.
Wenn Bund, Landesregierungen und die Netzbetreiber zusammen darauf hinwirken, wird ein leistungsfähiges, modernes und sicheres Kommunikationsnetz im Bereich der öffentlichen Sicherheit keine Vision bleiben – zum Wohl der Bevölkerung und der Resilienz hierzulande.
Event-Hinweis:
Am 20. Februar diskutieren bei der nächsten BASECAMP_Debate Jens Koch (Präsident der BDBOS), Alfons Lösing (Vorstandsmitglied bei o2 Telefónica), Clemens von Skwarczinsky (Managing Director Airbus Secure Land Communications) und Philipp Klein (Einsatzsteuerung bei der Berliner Feuerwehr) über die Zukunft der kritischen Kommunikation und der digitalen Funknetze.
Mehr Informationen:
Mobilfunk einfach erklärt: Was ist der Digitalfunk BOS?
Cybersicherheit: Was man bei der digitalen Kommunikation beachten sollte
Mobilfunk einfach erklärt: Was ist Resilienz?