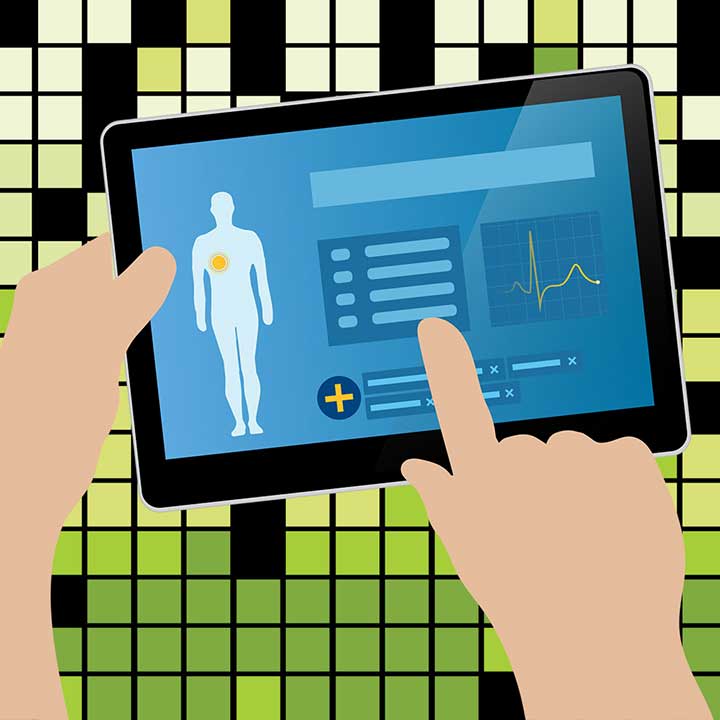E-Health: BMG plant App auf Rezept

Foto: CC0 1.0, Pixabay User StockSnap | Ausschnitt angepasst
Ärzte sollen ihren Patienten künftig auf Kosten der GKV digitale Gesundheitsanwendungen verordnen können – vorausgesetzt, sie werden zuvor vom BfArM zugelassen. Das sieht der Entwurf des Digitale Versorgung-Gesetzes (DVG) vor, den Gesundheitsminister Spahn am Mittwoch in die Ressortabstimmung gegeben hat. In Kraft treten soll es möglichst schon zum Jahreswechsel.

Patienten sollen sich künftig auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung von ihrem Arzt „digitale Gesundheitsanwendungen“ verschreiben lassen können. Das sieht der Entwurf eines Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale Versorgung-Gesetz – DVG) vor, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vergangenen Mittwoch in die Ressortabstimmung geschickt hat und das möglichst bereits zum Jahreswechsel in Kraft treten soll. Der Patient von morgen werde zwar noch immer einen Arzt brauchen, aber keinen Arzt mehr ernstnehmen, der nur mit Karteikarten arbeite, so Spahn bei der Vorstellung seines Vorhabens. Medizinern, die sich weigern, ihre Praxis an die für den Austausch von Daten erforderliche Telematikinfrastruktur (Ti) anzuschließen, drohen laut Entwurf im kommenden Jahr weitere Honorarkürzungen.
Dem Vernehmen nach hatten sich im April erst 64.000 der insgesamt 176.000 Arzt- und Zahnarztpraxen mit den erforderlichen technischen Komponenten ausgestattet. Bis Ende Juni dürften es laut Bundesgesundheitsministerium (BMG) rund 110.000 sein. Den übrigen Praxen droht gemäß § 291 SGB V ab Juli eine Kürzung ihrer „Vergütung vertragsärztlicher Leistungen“ um ein Prozent. Erfolgt der Anschluss auch bis März 2020 nicht, soll der Abschlag laut Gesetzentwurf auf 2,5 Prozent steigen.
„Die Erhöhung der Kürzung ist angemessen, weil sie nur für diejenigen Anwendung findet, die schon mehrere Fristen haben verstreichen lassen“,
heißt es dazu in der Begründung.
Um sicherzustellen, dass Patienten digitale Anwendungen auch flächendeckend nutzen können, sollen Apotheken und Krankenhäuser mit dem Gesetz nun ebenfalls dazu verpflichtet werden, sich an die Ti anzuschließen. Die knapp 19.500 Apotheken bekommen dafür bis 31. März 2020, die knapp 2.000 Kliniken bis 1. März 2021 Zeit. Stationären und ambulanten Pflege- sowie Rehaeinrichtungen, Hebammen, Entbindungspflegern und Physiotherapeuten wird die Anbindung an die Ti dagegen freigestellt. Die technischen Voraussetzungen dafür soll die verantwortliche Gesellschaft für Telematik (gematik) bis Ende Juni 2020 schaffen. Wer sich für den Anschluss entscheidet, bekommt „ab dem 1. Juli 2020 die Anschluss- und Betriebskosten […] in der gleichen Höhe erstattet wie der ambulante ärztliche Bereich“, so der Gesetzentwurf.
G-BA im Zulassungsverfahren außen vor
Für Versicherte soll im neuen § 33a SGB V ein „Anspruch auf Versorgung mit Medizinprodukten niedriger Risikoklasse“ geschaffen werden,
„deren Hauptfunktion wesentlich auf digitalen Technologien beruht und die dazu bestimmt sind, bei den Versicherten oder in der Versorgung durch Leistungserbringer die Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder die Erkennung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen zu unterstützen“.
Denkbar seien etwa digitale Tagebücher für Diabetiker oder aber Apps, die beispielsweise Menschen mit Bluthochdruck an die Einnahme ihrer Medikamente erinnern, sagte Spahn am Mittwoch. Welche Anwendungen nach Verschreibung durch den Arzt von der Krankenkasse erstattet werden können, soll nach dem Willen des Ministeriums jedoch nicht der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), sondern das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entscheiden. Laut Handelsblatt heißt es dazu im BMG, die aufwendigen Verfahren im G-BA stellten viele Start-ups vor zu hohe Hürden. Zudem handele es sich bei den infrage kommenden Apps um Medizinprodukte, an die nicht die gleichen Anforderungen wie etwa an verschreibungspflichtige Medikamente oder an Herzschrittmacher gestellt werden müssten.
Das Zulassungsverfahren wird im neuen § 139e SGB V geregelt. Danach soll das BfArM auf Antrag eines Herstellers binnen drei Monaten über eine Aufnahme in das von der Behörde zu führende amtliche „Verzeichnis erstattungsfähiger digitaler Gesundheitsanwendungen“ befinden. Die Aufnahme erfolgt,
„sofern die Erfüllung der Grundanforderungen an Sicherheit, Funktionalität und Qualität der digitalen Gesundheitsanwendung sowie deren positive Versorgungseffekte nachgewiesen sind“,
heißt es dort. Liegt ein Nachweis positiver Versorgungseffekte noch nicht vor, kann eine Anwendung für maximal zwölf Monate vorläufig in das Verzeichnis aufgenommen und von den Kassen erstattet werden. Gelingt der Nachweis nach Ablauf der Frist nicht, kann sie seitens des BfArM entweder nochmals um bis zu zwölf Monate verlängert werden, falls „aufgrund der vorgelegten Erprobungsergebnisse eine überwiegende Wahrscheinlichkeit einer späteren Nachweisführung“ besteht. Andernfalls sei die Anwendung „aus dem Verzeichnis zu streichen und eine erneute Antragstellung frühestens nach 12 Monaten und nur dann zulässig, wenn neue Nachweise […] vorgelegt werden.“ Die Details zum Verfahren will das BMG in einer gesonderten Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates regeln.
Wie bei neuen Arzneimitteln sollen die Hersteller digitaler Gesundheitsanwendungen den Preis im ersten Jahr frei gestalten können. Allerdings behält sich das BMG vor, in der Rechtsverordnung auch „Höchstbeträge für Gruppen vergleichbarer digitaler Gesundheitsanwendungen, auch in Abhängigkeit vom Umfang der Leistungsinanspruchnahme in der gesetzlichen Krankenversicherung“ festzulegen. Nach Ablauf des ersten Jahres sollen dann die zwischen GKV-Spitzenverband und Hersteller zwischenzeitlich vereinbarten Vergütungsbeträge gelten. Kommt keine Vereinbarung zustande, soll eine Schiedsstelle binnen drei Monaten die Beträge festlegen.
Datenmitnahme und -spende ab 2022
In den elektronischen Patientenakten (ePA), die alle Krankenkassen ihren Versicherten spätestens ab dem Jahr 2021 anbieten müssen, sollen nach dem Willen des BMG ab April 2021 auch der Impfausweis, das Zahn-Bonusheft, das Untersuchungsheft für Kinder sowie der Mutterpass gespeichert werden können. Die entsprechenden technischen Voraussetzungen habe die gematik bis dahin zu schaffen. Ab Januar 2022 sollen Versicherte zudem beim Wechsel ihrer Krankenkasse die Daten in eine andere zugelassene ePA übertragen und ab Juli 2022 zu medizinischen Forschungszwecken zur Verfügung stellen können. Vertragsärzte und -zahnärzte sollen ab Juli 2020 „für die Unterstützung bei Anlage und Verwaltung der elektronischen Patientenakte sowie für die Speicherung von Daten“ eine gesonderte Vergütung erhalten, Kliniken winkt ab 2022 pro Fall, für den sie im Zuge der Behandlung entstandene Daten in der ePA speichern, ein Zuschlag in Höhe von fünf Euro. Damit werde ein „wirksamer Anreiz für die Krankenhäuser gesetzt, die elektronische Patientenakte einzuführen“. Umgekehrt droht den Kliniken ab 2022 ein Abschlag von einem Prozent ihres Rechnungsbetrags pro Fall, sollten sie sich nicht fristgemäß an die Ti angeschlossen haben.
Ärzten, die Videosprechstunden anbieten, will das BMG per Änderung des Heilmittelwerbegesetzes künftig erlauben, dass sie auf ihrer Webseite über das Angebot informieren. Zudem wird durch Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches klargestellt, dass die Aufklärung durch den Arzt und die Einwilligung des Patienten zur Videosprechstunde nicht mehr zwingend in der Praxis erfolgen muss, sondern auch „unter Einsatz der für die Behandlung verwendeten Fernkommunikationsmittel“ geschehen kann. „Bei der Videosprechstunde ist eine dem unmittelbaren Arzt-Patienten-Kontakt vergleichbare Gesprächssituation gegeben“, so die Begründung. Extrabudgetär sollen Ärzte zudem für den Austausch per „Telekonsil“ vergütet werden.
Papier als Auslaufmodell
Um Praxen zum Einsatz elektronischer Arztbriefe anstelle des Faxes anzureizen, erhält der Bewertungsausschuss den Auftrag, „die Vergütung eines Telefaxes im EBM in zwei Schritten deutlich zu reduzieren“. Aktuell erhalten Ärzte pro verschicktem Fax 55 Cent. Für den Versand eines eArztbriefes bekommen sie dagegen nur 28 Cent, für deren Empfang 27 Cent. Entsprechend lautet die Vorgabe im Gesetzentwurf, die Gebührenposition zum Versenden eines Briefes bzw. Faxes „in einem ersten Schritt der Höhe nach mindestens zu halbieren. In einem zweiten Schritt ist der festgelegte Betrag nach Ablauf eines Jahres mindestens erneut zu halbieren.“ Darüber hinaus soll in Pilotvorhaben der Einsatz elektronischer Verordnungen in der Heil- und Hilfsmittelversorgung getestet werden. Das Vorhaben ergänzt die im Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) geplante Regelung zum elektronischen Rezept. Das GSAV dürfte der Bundestag aller Voraussicht nach am 6. Juni in zweiter/dritter Lesung beschließen. In dem Fall könnte der Bundesrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 28. Juni seine Zustimmung erteilen.
Krankenkassen will das BMG mit dem DVG darüber hinaus erlauben, bis zu zwei Prozent ihrer jeweiligen Finanzreserve in Start-ups und kleine Unternehmen zu investieren, um damit die Entwicklung digitaler Innovation zu fördern.
„Dabei sind die Mittel so anzulegen, dass die Kapitalbindungsdauer zehn Jahre nicht überschreitet, die Rückzahlung der Mittel gewährleistet erscheint und ein angemessener Ertrag erzielt wird.“
Zudem soll der freiwillige Beitritt in eine gesetzliche Kasse künftig auch auf elektronischem Wege möglich sein. Umgekehrt soll den Krankenkassen gestattet werden, ihre Versicherten mit deren Zustimmung in Zukunft auch elektronisch über innovative Angebote zu informieren.
Der 2015 mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) geschaffene und zwischen 2016 und 2019 mit jeweils 300 Millionen Euro pro Jahr ausgestattete Innovationsfonds soll – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – mit einem Volumen von 200 Millionen Euro jährlich bis 2024 verlängert werden.
Reaktionen
Der für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständige Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tino Sorge, sprach bei Twitter von einem „Quantensprung“ und forderte, das SGB V müsse „zum e-Book werden“. Sein Pendant auf Seiten des Koalitionspartners, Dirk Heidenblut, nannte den Entwurf eine „gute Diskussionsgrundlage“. An einigen Stellen gehe der Entwurf aber zu weit, an anderen greife er zu kurz. „Darüber wird zu reden sein“, so Heidenblut.
Die „Verknüpfung digitaler Anwendungen mit Bonus-Programmen der Krankenkassen ist ein völlig falscher Anreiz“,
findet dagegen Achim Kessler, Obmann der Fraktion Die Linke im Gesundheitsausschuss. Notwendig seien stattdessen „sinnvolle und bindende Mindeststandards für digitale Anwendungen und eine gesellschaftliche Debatte darüber, welche Rolle digitale Technologien in der Gesundheitsversorgung einnehmen sollen und wie wir mit sensiblen Gesundheitsdaten umgehen.“ Zudem müssten die Haftungsfragen „dringend geklärt“ werden. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Maria Klein-Schmeink, wirft Spahn eine nach wie vor fehlende Strategie für die Digitalisierung im Gesundheitswesen vor. Von diesem Gesetz „hätten wir deutlich mehr erwartet“, der Inhalt sei „mehr als dürftig“. Klein-Schmeink bemängelt vor allem eine fehlende Beteiligung der Patienten und ihrer Verbände. Zudem müsse
„sichergestellt werden, dass bei der Nutzung von Gesundheitsapps auch zentrale Aspekte des Daten- und Persönlichkeitsschutzes gewährleistet sind.“
Der vorstehende Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Tagesspiegel Politikmonitoring auf UdL Digital. Stephan Woznitza schreibt als Chef vom Dienst zur Gesundheitspolitik und zu E-Health.