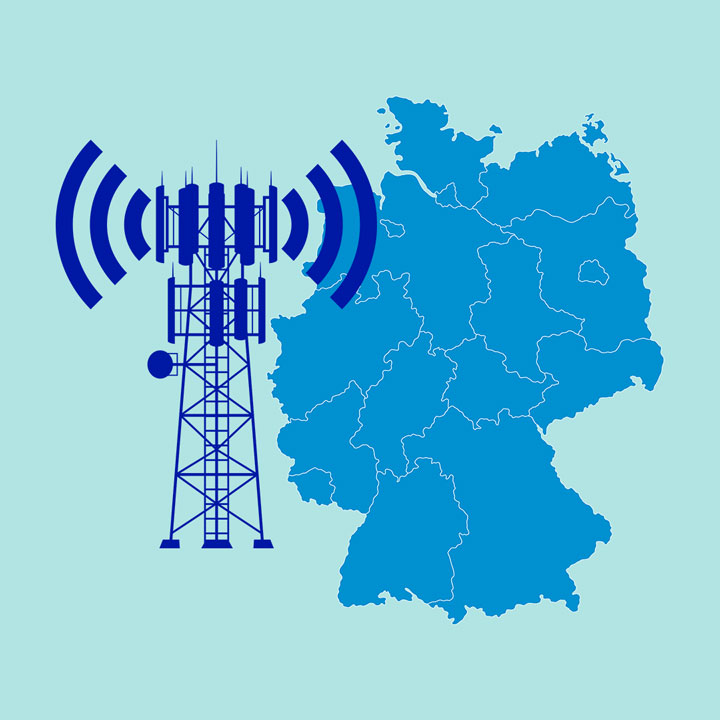Bundestagswahl 2025: Digitalpolitik in den Wahlprogrammen

Was plant die Politik nach der Bundestagswahl? Aufgrund des verkürzten Wahlkampfs kommen die politischen Inhalte diesmal gefühlt noch kürzer als sonst. Wir werfen gerade deshalb einen vergleichenden Blick auf die Wahlprogramme der Parteien und ihre Vorhaben in der Digitalpolitik.
Bei der Wahl des Bundestages am 23. Februar geht es neben vielen anderen Themen auch um die Frage, wie Deutschland digital fit gemacht werden soll. Ob Datenschutz, digitale Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, moderne Verwaltung, zukunftsweisende Bildung oder die Frage nach einem eigenen Digitalministerium – die Parteien im Bundestag haben durchaus unterschiedliche Vorstellungen.
Digitale Infrastruktur: Priorität Netzausbau
Bei der digitalen Infrastruktur als Grundlage der Digitalisierung betonen alle Parteien die Notwendigkeit eines schnellen und stabilen Netzes. Die SPD setzt auf den flächendeckenden Ausbau von Glasfaser und Mobilfunk, bleibt aber vage, wie genau der Ausbau vorangetrieben werden soll. CDU/CSU möchten das Ökosystem digitaler Infrastrukturen ganzheitlich ausbauen und
bestehende Hindernisse beseitigen – unter anderem mit der Einstufung des Netzausbaus als im überragenden öffentlichen Interesse.

Dies möchte auch die FDP umsetzen, den Netzausbau in einem Bundesministerium bündeln und zusätzlich für den Ausbau einer leistungsfähigen Rechenzentrumsinfrastruktur sorgen. Die Grünen wollen durch die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren bessere Rahmenbedingungen für den eigenwirtschaftlichen Netzausbau schaffen, zugleich aber auch den kommunalen und gemeinnützigen Netzausbau fördern. Zudem treten sie für eine „faire Preisgestaltung“ beim Internetzugang ein. Die Linke hebt ebenfalls den kommunalen und gemeinnützigen Netzausbau hervor, möchte den doppelten Ausbau oder Überbau vermeiden und die Preise deckeln.
Zwischen Datenschutz-Grundverordnung und Datenchancenpolitik
Beim Datenschutz werden die unterschiedlichen Ansätze der Parteien noch deutlicher. Während die Union mit einer alltagstauglichen DSGVO und pragmatischen „Datenchancenpolitik“, die sicher und gleichzeitig nutzerfreundlich sein soll, Innovationen fördern möchte, plädiert die SPD gerade in der digitalen Arbeitswelt für einen fairen Umgang mit Daten, aber auch zusätzliche Transparenzpflichten im Rahmen des Digital Services Act. Bei der Union ist zudem die Vorratsdatenspeicherung eine Option und in ihrem „Sofort-Programm“ kündigt sie die IP-Daten-Speicherpflicht an. Die SPD präferiert hier die Log-in-Falle.
Die Grünen möchten für einen effektiven, aber praktikablen Datenschutz das Datenschutzrecht vereinfachen und bürokratische Hürden abbauen. Gleichzeitig betonen sie Notwendigkeit, Datenschutz und Informationsfreiheit zu wahren – etwa bei der digitalen Patientenakte und im schulischen Bereich. Die FDP plädiert für mehr Freiraum und weniger Regulierung, setzt auf eine einheitliche Datenschutzaufsicht und möchte mit klaren Regeln für die Datennutzung ein innovationsfreundliches Umfeld schaffen.
Für die Linke ist vor allem der Schutz der informationellen Selbstbestimmung zentral, wozu ein Open Data- und Transparenzgesetz beitragen soll. Sie lehnt zudem Überwachungsmaßnahmen konsequent ab.
Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken abwägen
Auch beim Thema Künstliche Intelligenz prallen Regulierungsansätze und Innovationsförderung aufeinander: Die Linke betont die negativen Begleiterscheinungen von KI und fordert eine Kennzeichnung entsprechender Medieninhalte. Die Grünen stehen der Technologie grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, fordern aber bei der Nutzung den Einklang mit Freiheits- und Menschenrechten. Gleichzeitig plädieren sie für eine unbürokratische Umsetzung des AI Act. Dessen strikte Umsetzung möchte die SPD vorantreiben mit Maßnahmen wie Bot-Kennzeichnung und Faktencheck-Tools zur Bekämpfung von Desinformation. Sie setzt aber auch auf die Potenziale von KI – besonders im Gesundheitswesen, wo die elektronische Patientenakte so zu einem persönlichen Gesundheitsberater werden soll.

CDU/CSU sehen in Künstlicher Intelligenz einen wesentlichen Standortfaktor für Deutschland. Sie wollen KI-Anwendungen fördern, dabei aber auch sicherstellen, dass Sicherheitsbehörden diese Technologien nutzen können. Den AI Act möchte die Union dergestalt umsetzen, dass Bürokratie abgebaut und gleichzeitig Risiken beherrscht werden. Möglichst wenig Regulierung in diesem Zusammenhang wünscht sich dagegen die FDP, die Deutschland zu einem führenden KI-Standort machen möchte, insbesondere durch einen vereinfachten Zugang zu Forschungsdaten.
Großer Zuspruch fürs Digitalministerium
Bei der seit langem offenen Frage nach einem eigenen Digitalministerium auf Bundesebene sind sich fast alle großen Parteien diesmal einig: Sowohl Union und FDP als auch SPD und Grüne plädieren für ein Ministerium, das zentrale digitale Themen unter einem Dach vereint, Kompetenzen bündelt und durch Bürokratieabbau die Verwaltung digital modernisiert. Aus Sicht von CDU/CSU ist es außerdem essenziell, dieses Ministerium mit den nötigen Ressourcen auszustatten. Aus Sicht der FDP kann es nur mit dem neuen Ministerium gelingen, das angestrebte Once-only-Prinzip sowie den Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen zu realisieren.
Allein die Linke sieht den Aufbau eines Digitalministeriums eher skeptisch, da eine zu starke Zentralisierung den Zugang zu spezialisierten, dezentralen Lösungen behindern könnte. Dennoch erkennt sie an, dass ein klarer Rahmen und gebündelte Zuständigkeiten in der Verwaltung wichtig sind – solange dabei der Schutz der Bürgerrechte und die Förderung von Open-Source-Lösungen im Vordergrund stehen.
Tipp der Redaktion:

Bildung: Digitaler Unterricht und moderne Schulen
Im Bildungsbereich sind digitale Kompetenzen und moderne Unterrichtsmethoden für alle fünf Parteien wichtig, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Die SPD sieht den Digitalpakt Schule als Fundament des digitalen Fortschritts, bleibt jedoch vage in Bezug auf konkrete Maßnahmen zur Kompetenzvermittlung. CDU/CSU hingegen fordern eine verstärkte Integration von digitalen und Medienkompetenzen in den Unterricht sowie Informatik als Pflichtfach.
Die Grünen betonen zusätzlich zur technischen Ausstattung auch die Medienbildung und nachhaltige Konzepte, um Barrierefreiheit zu fördern. Die FDP setzt neben dem Digitalpakt 2.0 auf moderne Technologien wie KI-gestützte Lernplattformen, um Deutschland digital wettbewerbsfähig zu machen. Die Linke fordert Lernmittelfreiheit sowie den Einsatz von Open Educational Resources, um Schulen nicht von großen Software-Konzernen abhängig zu machen.
Alle Beiträge der Serie „Digitaler Wahlkampf“:
Bundestagswahl 2025: Social Media im Wahlkampf der Parteien
Bundestagswahl 2025: Die Social-Media-Kommunikation der Spitzenkandidaten
BSW und AfD sehen Digitalisierung eher negativ
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass während SPD und Grüne in der Digitalpolitik eher einen regulierenden Ansatz verfolgen, CDU/CSU und FDP stärker auf Innovationsförderung und wirtschaftliche Chancen setzen. Die Linke dagegen legt den Fokus auf Datenschutz, Open Source und soziale Unterstützung.
Im Gegensatz dazu konzentrieren sich BSW und AfD auf einige wenige digitale Themen. So sieht die AfD bei KI-Systemen zugleich Wachstumschancen und Risiken, fordert statt einer Regulierung durch die EU aber „praxisnahe, nationale Lösungen“. Den Datenschutz bringt sie gegen „totalitäre Strukturen“ durch digitale Anwendungen in Stellung und spricht sich in der Bildung gegen Online-Unterricht sowie die ausschließliche Verwendung von Tablets aus.
Ein paar mehr digitalpolitisch relevante Punkte finden sich beim BSW: etwa die Betonung einer eigenständigen digitalen Infrastruktur in Europa und von Open-Source-Software oder die Idee eines zentralen Online-Portals für Bürger und Unternehmen für alle behördlichen Dienstleistungen. Zugleich warnt die Partei vor neuen Bürokratielasten durch die Digitalisierung, lehnt digitale Lernmethoden ab und möchte die nichtdigitale Teilhabe am öffentlichen Leben schützen.
Wahlservice
Wenn Sie ihre eigenen digitalpolitischen Positionen mit denen der Parteien abgleichen möchten, können Sie dies beim Bitkom-Mat tun.
Die Wahlprogramme der Parteien zum Nachlesen finden Sie hier:
SPD, Union, Grüne, FDP, Linke, BSW, AfD
Mehr Informationen:
Bundestagswahl 2025: Was Bitkom, VATM und BDI von der Politik fordern
Neue Landesregierungen: Digitalpolitik in Brandenburg, Sachsen und Thüringen
Bundestagswahl 2025: Die nächste Debattenrunde zum Digitalministerium